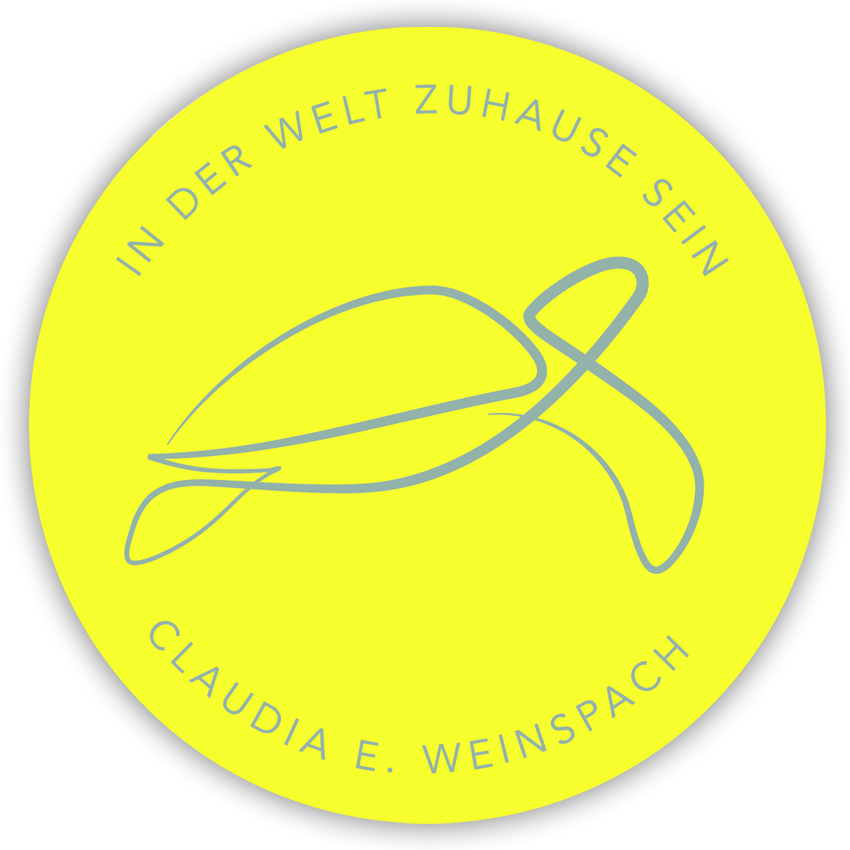April 2025

Gute Taten, gute Menschen? Warum uns diese Kategorien nicht weiterhelfen können
Wussten Sie, dass jedes Jahr am 6. April der „Tag der guten Taten“ ist? Ein Aktionstag, der, so kann man im Internet nachlesen, in mehr als 100 Ländern begangen wird?
Ich hatten von diesem Tag bisher noch nie etwas gehört und kann nicht beurteilen, welche Bedeutung er tatsächlich hat. Aber dieses Jahr machte mich jemand darauf aufmerksam und brachte mich zu Gedanken darüber, was eigentlich „gute Taten“ sind.
Auf den ersten Blick ist das vielleicht eine verwunderliche Frage, denn bestimmt fallen Ihnen sofort Beispiele von guten Taten ein, mit denen Sie aktiv oder passiv zu tun hatten. Aber bei genauerer Betrachtung können sich da schon einige Fragen stellen, zum Beispiel: Ist das, was für Sie eine gute Tat ist, für andere Menschen auf jeden Fall auch eine? Gibt es neutrale Kriterien dafür, wann eine Tat gut ist?
Weitere Fragen ergeben sich, wenn wir von „guten Menschen“ sprechen. Ist jemand, der viele gute Taten vollbringt, deswegen ein guter Mensch? Was macht einen Menschen zu einem guten Menschen? Und wer beurteilt, ob er einer ist? Der Mensch selbst, seine Mitmenschen?
Da ich mich in meinem Selbstverständnis als Diplompsychologin und Psychotherapeutin in gewisser Weise als Expertin für Menschsein sehe, sind diese Fragen, so dachte ich mir, Grund genug, ihnen mal, sozusagen nachträglich zum kürzlichen „Tag der guten Taten“, etwas nachzuspüren.
Gut ist (nicht immer) gut
Was bezeichnen wir landläufig als gute Taten? Die Arbeit für eine der vielen, immer wichtigeren Tafeln in unserem Lande fällt mir da ein, oder Besuche in Krankenhäusern, Altenheimen und Hospizen, überhaupt die Unterstützung von Menschen, die hilfsbedürftig sind. Ebenso Erste Hilfe bei einem Unfall.
Bestimmt gehören auch Spenden für einen „guten Zweck“ dazu – schon wieder so ein Begriff. Verstehen wir darunter alle dasselbe unter einem guten Zweck? Und ist eine Spende von einem armen Menschen höher zu bewerten als von einem reichen?
Es gibt auch gute Taten „im Kleinen“: jemanden einfach mal anzulächeln, das extra gute Trinkgeld, der unerwartete Blumenstrauß, ein Geschenk – aus konkretem Anlass oder einfach so –, die spontane Hilfe bei einem Umzug, die Hilfe beim Ausstieg aus dem Bus, Gastfreundschaft ...
„Gut“ kann so eine Tat zunächst einmal aus der Perspektive desjenigen wirken, dem geholfen oder eine Freude gemacht wird. Aus der Perspektive des „guten Täters“ kann es etwas komplexer werden: Steckt reiner Altruismus dahinter? Oder gibt es auch noch andere Motive für seine gute Tat, ein Eigeninteresse, einen Hintergedanken?
Will ich jemanden mit meiner guten Tat zu etwas bewegen oder einen guten Eindruck machen, treibt mich mein schlechtes Gewissen, möchte ich von etwas anderem, nicht so Guten ablenken? Und wird meine gute Tat dadurch geschmälert?
Ein nicht ganz uneigennütziger Hintergrund kann auch verborgen im Unterbewusstsein liegen, etwa im Bedürfnis nach fehlender Anerkennung oder Liebe. Einer meiner Klienten hatte seinem Sohn viel beim Umbau seines Hauses geholfen. Einerseits lag das nahe, weil er handwerklich fit war. Andererseits war er wegen seines Alters nicht mehr ganz so belastbar wie früher, und so hatte er sich übernommen.
Rational betrachtet hatte er sich damit also selbst geschadet, doch wir kamen, als wir darüber sprachen, auf ein tieferes emotionales Bedürfnis, das dahintersteckte: Er hatte mithilfe seiner Aktivität die Liebe seines Sohnes spüren und sich damit weniger einsam fühlen wollen.
Andere Gründe für gute Taten im Unbewussten können auch in unbewältigten früheren Erfahrungen und darauf beruhendem Anerkennungsbedürfnis oder Geltungsdrang liegen.
Wenn so etwas zutrifft, ist die Tat deswegen natürlich für den Empfänger, sofern er Freude und einen Vorteil hat, keine schlechte Tat. Aber wir werden sie vermutlich trotzdem etwas anders bewerten als die Tat ohne jeden Hintergedanken – und auch der Empfänger wird seine Sicht etwas verändern, wenn er von den verdeckten Motiven erfahren sollte.
Umgekehrt gilt Ähnliches, wenn wir aus eindeutigen Motiven handeln und uneigennützig etwas Gutes tun wollen, die Tat aber beim Empfänger nicht so verstanden und nicht mit Freude aufgenommen wird – zum Beispiel, weil er sich nicht helfen lassen will, weil er Scham verspürt oder weil er befürchtet, sich revanchieren zu müssen. Dennoch kann eine solche Tat in gewisser Weise eine gute Tat sein, wenn auch keine wirklich geglückte.
Der Räuber und der Erzbischof
Knifflig kann es bei Taten werden, die jemandem schaden mit dem Ziel, dafür jemandem anderen etwas Gutes zu tun. Robin Hood, die historisch nicht belegte, legendäre englische Sagenfigur, ist ein Beispiel dafür. Er soll als „edler Räuber“ den Reichen genommen und davon den Armen gegeben haben. Auch hier kommt es sehr auf die Perspektive an, ob man sein Verhalten gut oder schlecht findet.
Manchmal geht es auch nur darum, jemandem anderen etwas zu nehmen, um in einer Notlage das eigene Überleben zu sichern. So wie 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Kölner Erzbischof Frings in einer Predigt erklärte, dass „in der Not auch der einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise (...) nicht erlangen kann.“
Menschen, die etwa Briketts von Eisenbahnzügen oder Lebensmittel stahlen, um nicht zu erfrieren und zu verhungern, sahen in den Worten des Erzbischofs eine Rechtfertigung für ihre Taten. Für den „Kohlenklau“ etablierte sich sogar das Wort „fringsen“.
Wir sehen: Die Intention ist wichtig, wenn auch nicht allein entscheidend bei der Bewertung von Taten. Beides, die Intention und die Tat sind Komponenten von jedem Handeln, und auf die Frage, ob es eine gute oder keine gute oder gar eine schlechte Tat ist, gibt es oft keine eindeutige Antwort. Wir können nicht ohne Weiteres definieren, es zähle nur die Tat, es zähle nur die Intention oder es müsse immer beides stimmig sein, damit es gut ist – weil es immer unterschiedliche Perspektiven auf das Gute in einer Tat geben kann.
Geschenk oder Deal?
Wenn ich nun die Urheberin oder der Urheber einer guten Tat bin, fühle ich mich vielleicht gut damit, bin selbst beschenkt von meiner Tat oder auch von der Dankbarkeit, die mir dafür entgegengebracht wird. Möglicherweise brüste ich mich auch damit, versuche, damit bei anderen einen „guten Eindruck“ zu schaffen. Oder aber ich halte die Tat für gar nicht so wichtig oder es ist mir gar nicht bewusst, was ich an Gutem damit ausgelöst habe.
Wenn mir mein Umgang mit meinen guten Taten nicht so sehr bewusst ist, kann ich mich selbst im Zusammenhang mit einer guten Tat fragen: Was war meine Absicht dahinter? War sie wirklich so „gut“? Habe ich das vielleicht auch für mich getan? Konnte ich überhaupt etwas zweifellos Gutes damit bewirken? Ist es wichtig für mich, dass die Tat auch von anderen registriert wird? Erfüllt mich das einfach so mit Befriedigung, oder erwarte ich dafür auch Dankbarkeit, benötige ich sie sogar selbst für meine Zufriedenheit?
Das mit der Dankbarkeit kenne ich auch von mir selbst. Weil ich generell empathisch bin und daher unter anderem auch die Bedürfnisse anderer Menschen gut mitbekomme, habe ich in früheren Phasen meines Lebens oft „wie selbstverständlich“ Dinge für andere gemacht, von denen ich wusste, dass sie ihnen guttun würden.
Aber das haben die Empfänger zuweilen noch nicht einmal gemerkt, und wenn doch, haben sie auf unterschiedliche Weise reagiert und es mir nicht unbedingt gedankt. Mein eigenes tieferes Bedürfnis in diesem Prozess des Miteinanders konnte ich mir schließlich eingestehen: Ich wünschte mir Dankbarkeit, Freude und Wertschätzung für meine Empathie wie auch die daraus resultierenden Taten.
Die Erkenntnis meiner mehrdeutigen Motivationslage hat mich dazu geführt, genauer zu überlegen, was ich eigentlich genau mit meinem Handeln bezwecke. Wenn es mir darum geht, dass ich etwas gebe, dann aber auch etwas zurückbekomme, ist es besser, wenn ich das auch zum Ausdruck bringe und meine Erwartung ausspreche, denn sonst besteht die Gefahr, dass ich irgendwann in eine Schieflage kommen und so frustriert werde wie eine Klientin, die mal zu mir sagte: „Ich habe meiner Familie all die Jahre so viel gegeben. Ich war immer für die Kinder da, ich war immer für meinen Mann da. Na und? Eine gute Ehefrau und Mutter zu sein, das lohnt sich nicht ...“
Wenn ich aber wirklich etwas schenke und nicht erwarte, dass darauf irgendeine bestimmte Reaktion erfolgen muss, dann gebe ich mein Geschenk oder tue meine gute Tat, lasse jegliche Vorstellungen über passende Reaktionen des Menschen innerlich los, und das war's. Dann ist der andere Mensch wirklich frei darin, was er mit dem Geschenk macht oder wie er mit meiner Tat umgeht. Ich erwarte dann nicht irgendeine Art von Gegenleistung. Das befreit nicht nur den Empfänger, sondern auch mich.
Das Urteil unserer Mitmenschen
Es hängt stark von Kultur und Gesellschaft ab, was eigentlich „gut“ ist – obwohl wir immer meinen, dass dahinter eine absolute Wahrheit stecken würde.
Oft tun wir etwas, von dem wir selbst überzeugt sind und was auch allgemein als gut befunden wird. Vielleicht machen wir es dann auch deswegen einmal wieder, weil wir damit Anerkennung finden können.
Ich habe mal in einer Zeitschrift einen Fragebogen gesehen, in dem mögliche gute Taten aufgelistet waren, die uns zu besseren Menschen machen können, und man konnte ankreuzen, was man selbst davon schon getan hat oder häufiger tut. Müll aufzusammeln gehörte auch dazu. In meinem letzten Urlaub habe ich tatsächlich hin und wieder mal ein bisschen Müll aufgesammelt ...
Nun weiß ich nicht, wie viel Müll ich aufsammeln müsste, damit ich aus Sicht der Fragebogenmacher ein richtig guter Mensch wäre – ich habe es ja auch nicht deswegen getan, sondern weil mich der Müll gestört hat und ich es richtig finde, wenn wir uns auch individuell für solche Dinge verantwortlich fühlen.
Die hinter den Fragebogen steckende Vorstellung war aber offensichtlich, gute Taten und gute Menschen könnten anhand einer imaginären Punkteskala ermittelt werden. Ein gutes Beispiel dafür, dass das Urteil der Gesellschaft, unserer Mitmenschen, darüber, was gut oder schlecht ist, durchaus bei der Frage, was gute Taten sind, eine Rolle spielt.
Eine Art von gesellschaftlicher Anerkennung in Gestalt eines guten Images, vor allem aber Aufmerksamkeit, suchen heute viele Unternehmen mit „Greenwashing“, d. h., sie kompensieren umweltschädliches Verhalten in der Produktion mit Spenden für Umweltprojekte, um sich damit ein besseres Image zu geben und von den Produktionssünden abzulenken. Keine wirklich ehrenhafte Strategie – aber sind die Spenden damit automatisch keine guten Taten mehr?
Das Thema Umwelt hat heute in der Gesellschaft einen viel höheren Stellenwert als in früheren Zeiten, in denen Unternehmen mit Greenwashing viel weniger Resonanz bekommen hätten. Das zeigt, dass unser Urteil darüber, was gut ist und was nicht, sich mit der Zeit wandeln kann. So gibt es heute immer mehr Menschen, aus deren Perspektive es keinesfalls eine gute, sondern eine schlechte Tat ist, wenn Sie ihnen als Gastgeber ein noch so kunstvoll zubereitetes Fleischgericht vorsetzen.
Komplimente, die früher tatsächlich als Freundlichkeit empfunden wurden, können heute als übergriffig oder geschmacklos rüberkommen. Wer als Mann einer Frau heute noch die Tür aufhält oder in den Mantel hilft, kann nicht mehr wie noch vor 50 Jahren darauf vertrauen, dass die Frau das als eine gute und freundliche Geste empfindet.
Mensch sein
So wenig eindeutig das mit den guten Taten ist, so vielschichtig ist das auch mit der Frage, ob gute Taten aus einem Menschen einen guten Menschen machen und was überhaupt einen guten Menschen ausmacht. Ehrlich gesagt lässt sich diese Frage genauso wenig eindeutig beantworten – nur dass die Tragweite des Urteils größer ist. Ob einer ein guter Mensch ist oder ob er Gutes tut, das ist eine Frage der Perspektive.
Hinter der Vorstellung von einem guten Menschen steckt immer eine Bewertung. Als ob es – wie in der bereits erwähnten Zeitschrift – eine Punkteskala gäbe, an der man die Qualität von Menschen und ihres Handelns messen könnte: Auf der einen Seite der Skala wären die ganz schlechten Menschen, und auf der anderen die besonders guten. Doch diese Skala gibt es nicht, jedenfalls keine für alle Menschen und Zeiten gültige.
Die Frage nach den guten Taten und den guten Menschen muss subjektiv bleiben und kann – auch in einem Kollektiv mit ausgewählten, für die Gruppe wichtigen Werten, wie bei der veganen Kost – in der allerletzten Instanz nur jeder für sich allein beantworten. Denn wir Menschen sind nun einmal komplexe Wesen mit Brüchen, Widersprüchen, positiven und negativen Taten – die je nach Perspektive anders erscheinen können.
Ob wir moralisch ethisch im Sinne eines „Gutseins“ handeln und uns als gute Menschen verstehen, können wir nur selbst beurteilen. Und eine Tat, die uns durch einen anderen geschieht, können wir zwar danach beurteilen, ob sie für uns gut oder schlecht ist, aber das schließt nicht aus, dass die Tat aus anderer Perspektive ganz anders zu beurteilen ist.
In unserer Moralentwicklung, wenn wir noch Kinder sind, geht es darum, ob das, was wir tun, bestraft oder belohnt wird, oder ob wir jetzt eine Regel einhalten oder nicht. Strafe und Gehorsam kennzeichnen eine der ersten Stufen der Moralentwicklung.
Aber nach und nach geht es dann darum, ein eigenes Gerechtigkeitsempfinden hervorzubringen. Die Fragen in der Auseinandersetzung mit uns selbst als Jugendliche und junge Erwachsene lauten dann: Ist für mich entscheidend, was das Kollektiv sagt? Oder ist das für mich in manchen Fällen nicht relevant, weil ich das völlig anders sehe. Und wie sehe ich das und warum?
Ich finde, dass es unsere Aufgabe ist, uns, weil wir Menschen sind, auch als Menschen zu entwickeln – aber nicht nur nach einer Norm, im Sinne von „jemand sagt, wie es gemacht wird“. Sondern darüber hinaus für sich selbst eine persönliche Vorstellung für das eigene Leben zu entwickeln. Das geht aber nur, wenn wir uns selbst schon etwas besser kennen. Fragen könnten sein: Nach welchen Werten handle und lebe ich? Was macht mein Menschsein aus? Was ist mein Beitrag in dieser Welt? Wohin möchte ich mich entwickeln? Und wie kann ich das als Mensch erreichen?
Ich möchte daher das Menschsein statt einer Bewertung in gut oder schlecht lieber ein bisschen auffächern unter der Fragestellung: Was gehört denn eigentlich zum Menschsein dazu? Was macht das Menschsein und auch das Entwicklungspotenzial von uns Menschen aus? Zum Beispiel das Denken, die Reflexionsfähigkeit, die Empathie, das Mitgefühl, die Fähigkeit, sich an Vergangenes zu erinnern und die Zukunft zu visionieren, kreativ zu sein usw.
Diesen Themen will ich hier im Blog in den nächsten Monaten nachgehen. Die Frage wird dann nicht mehr sein: Was macht eine Tat zu einer guten Tat? Und was einen Menschen zu einem guten Menschen? Sondern: Was macht uns Menschen zu Menschen? Zu den Menschen, die wir – in der Zeit, in der wir leben, ganz individuell und in unseren Gesellschaften – sind.
Bis zum nächsten Mal also!