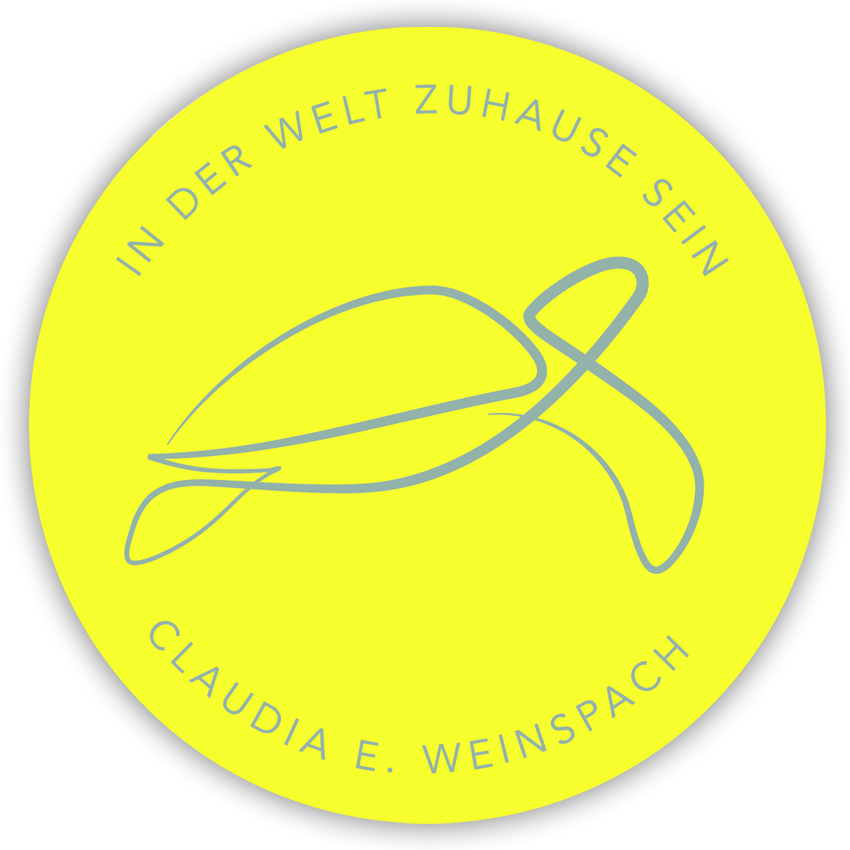August 2025

Beziehungen sind das Geflecht, das uns trägt
Was verschafft uns Menschen Wertschätzung von anderen? Wovon ist das abhängig? Viele von uns denken, dass sie umso mehr Liebe und Anerkennung bekommen, je mehr sie leisten. Dass die Wertschätzung sogar etwas ist, das sie sich erst verdienen müssen – durch Fleiß, Erfolg oder Status.
Doch das ist ein Irrtum. Die Frage, in welcher Beziehung wir zu anderen stehen, ist in Wahrheit unabhängig von Leistung. Es tut uns gut, wenn wir Beziehungserfahrungen machen, in denen wir spüren: Ich bin willkommen, so wie ich bin – mit meiner Stärke, aber auch mit meinen Grenzen.
Von solch einer Erfahrung, die ich selbst vor vielen Jahren machen durfte, möchte ich Ihnen heute erzählen. Und ausgehend davon will ich diesen Blogtext, nachdem ich in den letzten Beiträgen über Geist, Körper und Gefühle geschrieben habe, einem weiteren, grundlegenden Thema widmen: unseren Beziehungen und dem, was sie mit den Themen Scham, Würde und Integrität zu tun haben.
Denn ohne Beziehungen – zu anderen Menschen, zu uns selbst, zur Natur – wären wir nicht die, die wir sind. Sie sind das Geflecht, das uns trägt. Sie schenken uns Sinn, Gesundheit und Würde.
Heilungszeremonie für meinen Fuß
Die Erfahrung, von der ich erzählen will, machte ich während meines Sabbatjahres 2003/2004 an der Milton Erickson Foundation in Phoenix. Ich arbeitete damals eng mit meinem Mentor und Lebensfreund Carl Hammerschlag, Psychiater und Facharzt für Psychoneuroimmunologie zusammen.
Durch Carl begegnete ich auch Mona Polacca, einer Sozialpädagogin und Tochter von Manakaja, dem Häuptling der Havasupai. Ihre Ahnenreihe umfasst zudem Hopi- und Tewa-Vorfahren. Wir drei wollten gemeinsam einen Workshop leiten und hatten unsere Aufgabenbereiche untereinander aufgeteilt.
Carl war mit seiner Fachlichkeit zuständig für Ablauf und den intellektuellen Input, Mona brachte den Kern der indigenen Zeremonie, also das Beten, das Räuchern und eine Schwitzhüttenzeremonie mit ein. Und mein Part als Psychotherapeutin waren die Hypnosen, eine Herzchakrameditation am Morgen, die mir besonders am Herzen lag, aber auch erlebnisaktivierende kleinere Körperübungen oder Rollenspiele, zum Beispiel mit einer Handpuppe. Natürlich gehörte auch Gesang dazu, der unser gemeinsames Thema war.
Doch kurz vor Beginn des Workshops passierte es: Ich trat in ein giftiges Insekt. Innerhalb kürzester Zeit schwoll mein Fuß stark an. Er pochte, ich konnte kaum noch auftreten. In der Notaufnahme bekam ich Cortison – doch die Schmerzen blieben.
Vor allem aber traf mich das Gefühl, nun für diesen Workshop auszufallen. Denn ich konnte nicht laufen, nicht stehen, nicht das tun, wofür ich dort war. Ich fühlte mich nutzlos und empfand ein Gefühl der Scham dafür, hier zu versagen und nicht in der vorher besprochenen Weise funktionieren zu können.
Carl und Mona aber sahen, wie es mir ging – und initiierten eine Heilungszeremonie für mich.
Alle Teilnehmenden wurden eingeladen, mir etwas zu schenken – was auch immer ihnen in den Sinn kam: eine Geste, ein Wort, ein Lied, eine Berührung. Und tatsächlich: Keiner musste mitmachen, aber alle taten es. Einer nach dem anderen kam zu mir. Manche legten eine Hand auf meinen Fuß, andere sahen mich einfach an. Manche sangen, manche sprachen nur ein paar Worte. Zehn, fünfzehn Minuten lang floss eine Welle an Zuwendung zu mir.
Im ersten Moment schämte ich mich fast noch mehr, weil ich da so mit hochgelegtem Fuß auf dem Präsentierteller saß. Aber nach und nach löste sich die Spannung in mir, und dann weinte ich – aus Rührung, aus Erleichterung, auch weil die ganze Scham von mir abfiel. Denn plötzlich spürte ich: Ich falle nicht aus meiner Gruppe heraus, nur weil ich gerade nichts leisten kann. Ich gehöre dazu.
Natürlich war die Entzündung nicht auf magische Weise verschwunden. Mein Fuß blieb noch Tage geschwollen und schmerzhaft. Aber etwas Grundlegendes hatte sich verändert. Der Schmerz trat in den Hintergrund. Ich war nicht mehr nur „Fuß“, nicht mehr nur Problem. Ich war wieder ganz da – Teil einer Gemeinschaft, die mich hielt. Und dieses Gefühl von Würde, von Angenommen-Sein wirkte mindestens so heilend wie jedes Medikament.
Mehr als Funktionieren
Als ich vor einigen Wochen in Zürich ein Seminar auf einer hypnosystemischen Tagung gab, die „Schamlos und würdevoll – Selbstwirksamkeit erleben“ hieß, musste ich wieder an dieses Erlebnis denken. Denn dort kristallisierte sich eine Erkenntnis heraus, die genau das beschreibt, was ich damals dort elebte: Würde ist wichtiger als Wohlbefinden.
Damit ist gemeint: Wenn ich in meiner Integrität, in meinem Verbundensein mit dem Sinn, mit dem, was ich bin und was ich mit meiner Umgebung bin, dann ist das zum einen viel prägender als so ein vorübergehender Schmerz wie der durch diesen Insektenbiss. Und es ist auch viel wichtiger als die Frage, ob ich nun bei solch einem Workshop wie vorgesehen funktioniere und alles so läuft wie geplant.
Würde bedeutet in diesem Zusammenhang: Ich bin mehr als das, was funktioniert. Ich bin Teil eines Gefüges. Ich darf auch mal ausfallen, darf Grenzen haben und zeigen. Und ich darf lernen, darf wachsen. Das scheint etwas zu sein, was uns Menschen ganz basal trägt.
Wenn wir uns dagegen nicht mehr als wertvoll erleben, sondern als dysfunktional, als belastend, als versagend, verlieren wir etwas Tieferes als nur Gesundheit. Wir verlieren unsere innere Integrität.
Wir alle brauchen ein Umfeld, das uns bestärkt. Beziehungen, in denen wir und das, was wir tun, nicht bewertet, sondern begleitet werden. Gemeinschaften, in denen Würde mehr zählt als Leistung.
Die Erfahrung damals in Phoenix hat mich tief geprägt. Denn was da geschah, war mehr als Trost: Es war eine Würde-Erfahrung. Ich durfte erfahren, dass ich auch dann dazugehören darf, wenn ich nicht leisten kann.
Würde und Scham
Ich möchte heute an dieser Stelle das Thema noch ein wenig vertiefen, damit Sie den Gesamtzusammenhang von Integrität, Würde, Scham und Beziehung noch besser nachvollziehen können.
Unsere persönliche Würde ist ein häufig missverstandenes Thema. Viele von uns vergessen, dass die Würde nicht davon abhängt, ob wir von außen anerkannt werden. Grundsätzlich muss uns niemand einen bestimmten Wert zuerkennen, damit wir uns selbst würdig fühlen können. Unsere persönliche Würde ist eine angeborene Eigenschaft, sozusagen eine "Werkseinstellung".
Aus diesem Grunde spricht unser Grundgesetz auch davon, die menschliche Würde sei unantastbar. Aber natürlich ist es dennoch so, dass wir das Gefühl für unsere Würde verlieren können, wenn wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, ausgegrenzt zu werden oder gedemütigt, unterdrückt oder gemobbt zu werden. Dann fühlt sich das so an, als wären wir weniger wertvoll. Die Würde an sich ist zwar jetzt theoretisch nicht weg, weil sie ja unantastbar ist, aber dadurch, dass wir sie nicht mehr fühlen, scheint sie dennoch auch nicht mehr da zu sein.
In der Therapiearbeit mit Menschen, die aufgrund von Gewalterfahrungen, die sie gemacht haben, an einer komplexen Traumafolgestörung leiden und damit auch umfassend das Grundgefühl von Würde- und Wertverlust entwickelt haben, zeige ich manchmal einen Geldschein und frage, was der wert ist. 20 Euro zum Beispiel. Dann zerknülle ich den Geldschein, schmeiße ihn auf den Boden und trample darauf rum, so dass er nicht mehr so schön unberührt aussieht wie zu Beginn. Dann hebe ich ihn auf und frage wieder: Was ist dieser Geldschein nun wert? Ja, er ist immer noch 20 Euro wert.
So wie beim Geldschein verschwindet unser Wert nicht wirklich, wenn wir verletzt und “entwürdigt” werden – aber wir können das Gefühl für unsere kostbare Integrität, das im Selbst-Bewusst-Sein verankert ist, verlieren. Würde und Verletzlichkeit gehen immer Hand in Hand. Denn unsere angeborene Würde hängt direkt von unserem emotionalen Gleichgewicht und unserem Selbstwertgefühl ab.
Hier kommt auch die Scham ins Spiel, der Gegenspieler zu unserem Würdeempfinden. Der indische Schruftsteller Salman Rushdie beschreibt die Scham sehr anschaulich so: „Scham ist eine Flüssigkeit, die in einen Becher gefüllt wird. Wenn zu viel Scham da ist, fließt der Becher über."
Scham gehört zum Menschsein dazu – sie reguliert unsere Beziehungen. Doch wenn unser„Schamgefäß“ überläuft, wird sie toxisch: Wir fühlen uns minderwertig, überflüssig, nicht mehr zugehörig. Deswegen bedeutet, die Würde eines Menschen zu achten, aus Sicht der Scham-Psychologie, ihm oder ihr überflüssige, vermeidbare Scham ersparen, also dafür zu sorgen, dass der Becher eben nicht überfließt.
Der Sozialwissenschaftler Stephan Marks unterscheidet vier Themen von Scham: die Scham infolge von Missachtung, von Grenzverletzung, von Ausgrenzung und von Verletzungen unserer eigenen Werte – wenn also unsere Grundbedürfnisse nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität verletzt werden.
Damit der Scham-Becher nicht überfließt, geht es also jeweils darum, den Betroffenen einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem diese vier Grundbedürfnisse erfüllt werden.
Zwei Grundbedürfnisse
Ein gutes Würdeempfinden mit wenig Schamgefühl können wir entwickeln, wenn wir Zugang haben zu unserer inneren Stärke, zu einem Ich-bin-einzigartig-Gefühl, zum Stolz darauf, von anderen anerkannt zu werden, wenn wir unseren Beitrag einbringen und uns einer Gruppe zugehörig fühlen können.
Denn was uns Menschen, wenn man in Meta Studien sehr viele Faktoren analysiert, Sinn im Leben verleiht, können wir nach einigen Berechnungen auf nur zwei Grundbedürfnisse herunterbrechen.
Das erste Grundbedürfnis ist, dass wir uns in unserer Einzigartigkeit erleben können, also dass wir etwas in dieser Welt tun können, wovon wir subjektiv und ganz persönlich das Gefühl haben, dass es uns entspricht. Das kann zum Beispiel eine Aufgabe sein, der wir uns widmen – aber nicht eine, die uns von unseren Mitmenschen willkürlich aufgetragen wird, sondern eine Aufgabe, in der wir uns wiederfinden, etwas, das zu uns past, eine Tätigkeit, die unserem eigenen inneren Antrieb entspringt und erfüllend ist.
Ob das nun eine Erwerbsarbeit ist oder etwas anderes für uns Nützliches, ist nicht entscheidend. Es geht hier vor allem darum, dass wir Sinn darin finden und dass wir uns dabei, wie man so schön sagt, „selbstverwirklichen“ können.
So zeigt sich Würde auch in der Beziehung zu uns selbst – als Integrität, wenn wir im Einklang mit unseren Werten handeln. Sobald wir tun, was mit unserer inneren Überzeugung übereinstimmt, stärken wir unsere eigene Würde.
Die Frage, ob das, was wir da tun, für andere eine Bedeutung hat, ob es ihnen Nutzen bringt, ist für unsere eigene Integrität erst einmal nicht essenziell. Aber natürlich hat es trotzdem eine Bedeutung: weil dadurch natürlich auch ein Feedback entsteht, das wir von anderen bekommen können.
Das bringt mich zum zweiten Grundbedürfnis für uns Menschen: Wir alle brauchen das Gefühl, in einer Gruppe Zugehörigkeit zu erfahren, also getragen zu sein. Es geht dabei um Geborgenheit im weitesten Sinne: dass wir uns irgendwie eingebunden und angenommen fühlen von unseren Mitmenschen.
Das Gefühl, getragen zu sein, können wir auch auf andere Weise haben, zum Beispiel in der Natur, indem wir uns etwa verbunden mit der Erde fühlen, oder wenn wir einen Baum umarmen. Aber die Beziehung zu anderen Menschen ist besonders wichtig. Wir Menschen sind so gesehen Herdentiere, wir brauchen andere Menschen.
Grundsätzlich ist es so, dass Beziehungen am schönsten sind, wenn sie auch den ersten eben von mir genannten Faktor mit berücksichtigen: dass wir uns in unserer Einzigartigkeit erleben – und zeigen – können. Wenn wir also in einer Beziehung sind, in der das gelingt und in der wir dann deswegen anerkannt, gemocht und integriert werden, ist das die schönste Erfahrung, die wir uns gegenseitig schenken können.
Das hat etwas mit Liebe zu tun – nicht im romantischen oder erotischen Sinne, sondern es meint einfach einen liebevollen Umgang zwischen uns Menschen, also voller Mitgefühl, voller Bereitschaft, auch auf andere zu schauen, voller Achtsamkeit für sie und natürlich auch für uns selbst. Es führt dazu, dass es uns und den anderen besser geht, als wenn wir allein sind.
Besonders heilsam wird es, wenn beides zusammenkommt: Ich darf so sein, wie ich bin – und bin damit willkommen. Wenn wir beide Bedürfnisse – das nach dem Erleben unserer Einzigartigkeit wie auch das nach Zugehörigkeit in einer Gruppe, also nach innerer Integrität wie auch äußerer Integration – realisieren können. Manchmal hapert es an dem einen Bedürfnis, dann kann das eine das andere etwas ausgleichen. Schwierig ist es für uns, wenn wir beides über eine längere Zeitspanne nicht realisieren können.
Menschen, die über eine längere Zeit, zum Beispiel durch eine betriebliche Umstrukturierung, von Arbeitslosigkeit betroffen sind, geraten hier in der westlichen Gesellschaft, in der Leistung sehr groß geschrieben wird, in Gefahr, ihr Selbstbewusstsein zu verlieren, sich für ihre Arbeitslosigkeit zu schämen und sich dann sozial zurückzuziehen. Anders kann es verlaufen, wenn sie währenddessen in ihrem sozialen Umfeld – am besten in der Ausübung einer für sie sinnvollen Tätigkeit – die Erfahrung machen können: Ich bin immer noch für die Gemeinschaft wichtig, sie erkennt mich genauso an, wie ich bin. Diese Erfahrung ist gleichzeitig eine Würdeerfahrung – und diese empfundene Würde ist der Gegenspieler zur Scham, wirkt also schamreduzierend.
Wahres Glück entsteht durch Verbundenheit
Die Erfahrung von Würde in einer Beziehung zu anderen fördert unsere seelische und körperliche Gesundheit – und damit auch unser Gefühl von Selbstbestimmung und Autonomie. Das klingt ein wenig paradox, weil wir ja heutzutage meist meinen, Autonomie hätte etwas mit Unabhängigkeit und der Freiheit von Beziehungszwängen zu tun.
Tatsächlich fühlen wir uns aber am meisten autonom, wenn wir gleichzeitig geborgen sind. Sehr gut beobachten lässt sich das im Verhalten von Kindern: Wenn sie ein sicheres Nest haben und stabile Wurzeln, trauen sie sich, in die Welt hinauszugehen. Kinder dagegen, die sich in ihren Bindungen unsicher fühlen, zum Beispiel weil deren Eltern ihnen nicht ausreichend Rückhalt geben können, sind eher trennungsängstliche Kinder.
Autonomie, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Integrität, seelische und körperliche Gesundheit, Schamreduktion, Würde – all das gehört untrennbar zusammen und hängt mit unserer Beziehung zur Welt zusammen.
Inzwischen bestätigen auch neurowissenschaftliche Studien, was wir bereits intuitiv wissen: Soziale Ausgrenzung tut weh! Tatsächlich werden im Gehirn dieselben Schmerzareale aktiviert wie bei körperlichem Schmerz. Umgekehrt fördern Zugehörigkeit und Sicherheit Gesundheit, Lernfähigkeit und Entwicklung. Unser Gehirn braucht Beziehung – so wie unser Körper die Luft zum Atmen.
Wir alle brauchen Beziehungserfahrungen, in denen wir uns geliebt und angenommen fühlen – doch nicht im rosaroten Hollywood-Sinn, sondern auf einer ganz basalen Ebene: Mitgefühl, Angenommensein, Dazuzugehören, das brauchen wir alle. Liebe und Anerkennung müssen wir uns nicht durch Leistung verdienen, denn die bringt vielleicht Bewunderung oder Status, aber echte Beziehung – das Gefühl, geliebt und angenommen zu sein – ist unabhängig davon. Und weil wir Menschen das alle unbedingt brauchen, ist es eine gute Idee, diese Erfahrungen sich selbst und auch anderen zu geben.
Wenn wir einander mit Respekt, Achtsamkeit und Mitgefühl begegnen, dann schenken wir uns das Wertvollste überhaupt: das Gefühl, angenommen und würdig zu sein. Wahres Glück entsteht, wenn wir uns derart verbunden fühlen. Mit uns selbst, mit anderen, mit der Welt – und auch mit unseren Vorfahren und unseren Nachkommen.
Dieser auf die vorhergehenden und uns nachfolgenden Generationen gerichtete Blick fiel mir heute Morgen wieder ein, als ich ein Vorstellungsgespräch mit einem Bewerber für ein 6-monatiges klinisches Praktikum in unserer Praxis führte. Nachdem ich ihm erläutert hatte, welche Möglichkeiten das Praktikum bietet, sagte er mir, alles passe sehr gut für ihn – und wirkte gleichzeitig dabei ein wenig überrascht.
Und so fragte er mich als Nächstes: „Was ist eigentlich Ihr Beweggrund dafür, dass Sie mir dieses tolle Praktikum anbieten?“ Ich sagte ihm, ich hätte selbst Geschenke bekommen und wollte sie weiter teilen ... Da geschah es plötzlich – ich musste wieder an Mona denken und hörte sie sofort in meinem inneren Ohr. Ich wusste, was sie jetzt sagen würde: dass ich dabei sei, meinen Blick auf die nächsten Generationen zu richten.
Denn der achtsame Blick auf sieben Generationen in die Zukunft ist hinsichtlich der Ziele und Entscheidungen bei den Nordamerikanischen indigen Völkern ebenso notwendig und zentral wie der Blick zurück und die Würdigung der letzten sieben Generationen, auf deren Schultern wir Menschen stehen und von dort weiter wachsen.
„Nobody makes it alone“, pflegte Carl immer zu sagen. Die Beziehung zu unseren Vorfahren und unseren Nachkommen – auch sie gehört zu dem Geflecht, das uns trägt. Sicherlich werde ich auch auf dieses Thema in einem meiner nächsten Blogs näher eingehen.