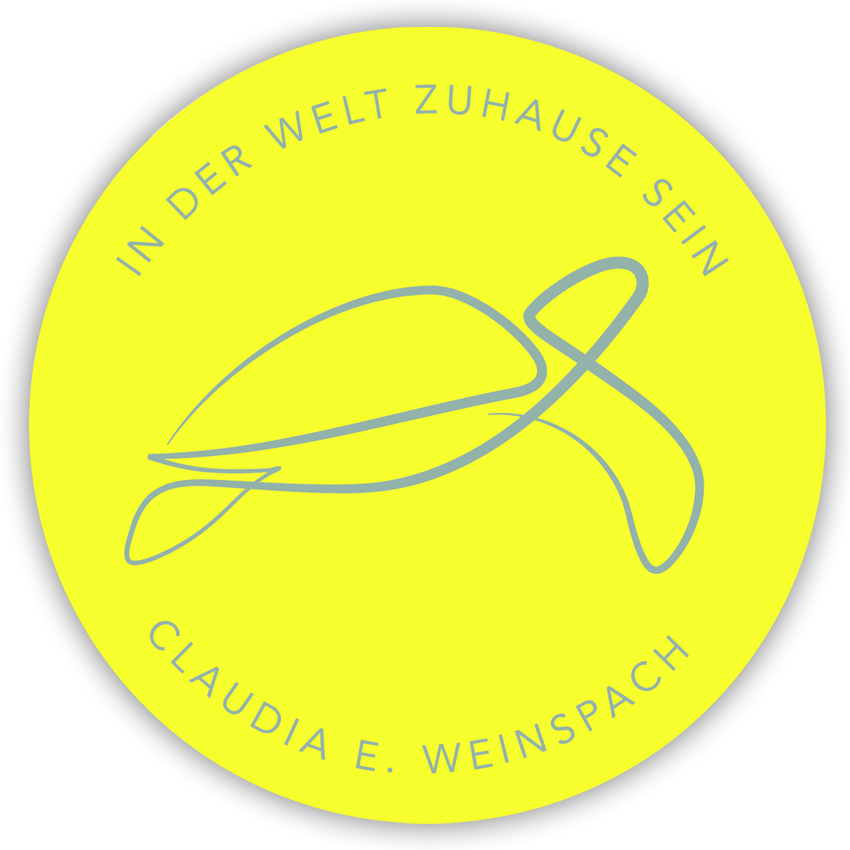Juli 2025

Unser Körper gehört uns nicht – er ist unser Gegenüber
„Mein Körper hat nicht so mitgemacht, wie ich das wollte.“ Solch einen Satz haben Sie bestimmt schon gehört – und vielleicht sogar auch selbst einmal gesagt oder gedacht. Wir sind eben manchmal unzufrieden mit unserem Körper, weil er uns nicht so „gehorcht“, wie wir uns das wünschen, und weil er uns nicht immer zuverlässig das liefert, was wir von ihm erwarten.
In eine ähnliche Richtung gehen auch Äußerungen wie „mein Rücken macht nicht mehr mit“, „ich habe Schlafprobleme" „oder „ich bin ständig müde.“ Immer schwingt darin die Vorstellung mit: Der Körper ist ein Ding, das eigentlich funktionieren sollte. Und wenn er es mal nicht tut, dann scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.
Meist suchen wir nach zeitnahen Ursachen für die Störung und vermuten dann die Schuld bei uns, weil wir wohl etwas falsch gemacht haben. Vielleicht waren wir nicht diszipliniert genug, haben uns nicht gut genug ernährt, zu wenig bewegt, zu viel gearbeitet. Oder wir haben einfach nicht genug auf unseren Körper „gehört“.
An diesen Interpretationen ist wahrscheinlich häufig auch wirklich etwas dran, denn unsere Lebensführung beeinflusst auch das körperliche Wohlbefinden. Aber mir geht es heute um etwas anderes – nämlich um unsere Erwartung, unser Körper müsste immer das tun, was wir von ihm erwarten. Wir glauben, er gehöre uns. Wir könnten ihn kommandieren wie ein Werkzeug. Er hätte gefälligst zu funktionieren. Als wäre er unserEigentum.
Doch ich möchte dieser Sichtweise widersprechen. Lassen Sie uns also diesmal, nachdem wir uns zuletzt mit unserem Geist und unseren Gefühlen beschäftigt haben, auf unseren Körper schauen und darauf, wie er mit Geist und Gefühlen interagiert. In einem anderen Blick auf unseren Körper kann ein Weg liegen – nicht nur zu mehr Gesundheit, sondern zu einem anderen Verständnis von unserem Menschsein.
Der Körper als Mittel zum Zweck
Die Vorstellung, dass der Körper uns "gehört", führt zu einem paradoxen Umgang: Entweder versuchen wir, ihn zu beherrschen – durch Kontrolle, Training, Disziplin – oder wir überlassen ihn sich selbst, bis er streikt. In der einen Variante soll er fit, schön, leistungsfähig und kontrollierbar sein – wie ein Auto bei der Sorte von Menschen, die beständig daran herumschrauben, es dauernd auftunen, aufmotzen und checken, damit es Aufsehen erregt, uns soziale Anerkennung verschafft und zuverlässig bei der Erreichung von Zielen unterstützt.
Oder wir bemerken unseren Körper erst, wenn er schmerzt. Auch da hilft der Vergleich mit dem Auto und der Art, mit der andere Zeitgenossen mit ihm umgehen: Sie bringen es regelmäßig zur Inspektion und zum Tanken, und wehe, wenn es liegen bleibt – dann bringen sie es zur Reparatur. Wenn die Reparatur gemacht wurde, erwarten sie, dass sie mit ihrem Körper genauso umgehen können wie vorher.
Da muss ich an einen Artikel von einem Chirurgen denken, den ich neulich gelesen habe. Er arbeitete im Bereich Kardiologie und hatte viele Jahre seinen Patienten Stents gesetzt. Er fand es befriedigend, dass er damit Menschen helfen konnte, die einen Herzinfarkt erlitten hatten. Doch mittlerweile hat er sich davon abgewandt, weil er beobachtet hat, dass die Patienten danach in der Regel nicht das tun, was sie eigentlich tun müssten, um besser leben zu können – nämlich ihren Lebensstil zu ändern. Alle, so seine Erfahrung, verlassen sich darauf, dass es mit den Stents schon wieder „normal“ weitergehen wird.
Beide Arten des Umgangs – wenn der Körper optimiert wird oder wenn er ignoriert wird – haben eines gemein: Der Körper ist dabei Mittel zum Zweck.
Diese Sichtweise ist tief in uns und unserer Gesellschaft verankert. Aber der Körper ist kein Ding, kein funktionierendes Objekt. Es stimmt, er ist ein Teil von uns – aber nicht so, wie ein Schraubenzieher Teil unserer Werkzeugkiste ist. Sondern eher wie ein Gegenüber, mit dem wir in Beziehung stehen.
Ständige Wechselwirkung
Dass der Körper so eng mit dem zusammenhängt, was wir denken und fühlen, ist lange Zeit nicht so klar gesehen worden. Die Psychologie hat versucht, Geist und Körper zu trennen. Doch die Forschung der letzten Jahre zeigt: Diese Trennung ist künstlich. Die Systeme sind verwoben, ineinander verschränkt, in ständiger Wechselwirkung.
Unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen den Körper: Stress erhöht den Blutdruck, Angst lähmt die Muskulatur. Trauer drückt die Schultern. Die Erkenntis, dass körperliche Beschwerden psychosomatische Ursachen haben können, ist mittlerweile weit verbreitet – wenn auch die die Wirkung der Psyche auf den Körper dabei oft noch viel zu einseitig und linear betrachtet wird.
Aber dass die Beeinflussung auch umgekehrt geht, haben die meisten von uns weniger im Fokus: Wenn wir unseren Körper bewegen, hellt sich unsere Stimmung auf. Wenn wir tief durchatmen, wird unser Kopf klarer. Wenn wir besser schlafen, können wir besser lernen und denken. Doch alles braucht eine Balance und das Maß für die richtige Dosis.
Wie wir mit unserem Körper umgehen, hat also auch Einfluss auf unsere Gefühle, unser Gemüt. Gegen die ersten, offensichtlichen Impulse des Körpers zu handeln, ist manchmal sogar kontraintuitiv, zum Beispiel signalisiert Lethargie oder Müdigkeit nicht immer die Notwendigkeit, sich ins Bett zu legen. Wenn jemand an einer Depression leidet, schlage ich ihr oder ihm als eine der ersten Interventionen vor, für eine halbe Stunde einen Spaziergang zu machen, weil dabei körpereigene Endorphine ausgeschüttet werden, die Muskulatur gestärkt wird und dann wieder eher ein Gefühl von Leichtigkeit aufkommen kann.
Ich selbst habe mir aus diesem Grund vor der Arbeit etwas Bewegung angewöhnt und mache auch gerne Spaziergänge oder gehe im Sommer morgens im Dortmund-Ems-Kanal schwimmen. Die alltäglichste Form der Pflege meines Körpers und meiner Psyche ist allerdings meine Mini-Yogapraxis. Nach nur zehn Sonnengrüßen fühle ich mich friedlicher und ich habe andere Gedankenmuster. Ich bin dann insgesamt gelassener, ruhiger mit meiner innereren Welt verbunden, als wenn ich die Übungen ein paar Tage nicht mache. Und mit dem Meditieren oder auch mit Atemübungen ist es genauso, was mich selbst immer wieder erstaunt, doch tatsächlich kommt die Wirkung über den Körper sehr schnell. Und das bestärkt mich in der Umsetzung.
Diese Zusammenhänge zu verstehen, kann der Beginn eines lohnenden Perspektivwechsels sein. Unser Körper ist eben viel mehr als ein Mittel zum Zweck – er ist ein Mitspieler in einem Feld, in dem (soziale) Umwelt, Persönlichkeit, körperliche und psychische Faktoren wechselseitig miteinander und aufeinander wirken.
Achtsamkeit statt Kontrolle
Genauso, wie wir unsere Gefühle nicht unterdrücken, sondern mit ihnen in Beziehung treten sollten, so macht es also auch Sinn, sich regelmäßig seinem Körper freundlich zuzuwenden. Doch was heißt das eigentlich genau? Es heißt jedenfalls nicht, ihn zu überwachen. Achtsamkeit ist nicht das gleiche wie Kontrolle. Wer ständig auf Signale wartet, sie analysiert, interpretiert, überprüft, gerät leicht in eine Form der Selbstfixierung, die Angst machen kann. Der Unterschied zwischen achtsamer Körperwahrnehmung und hypochondrischer Körperfixierung ist schmal – aber entscheidend.
Ich selbst hatte zum Beispiel irgendwann mal merkwürdige schwarze Flecken vor dem linken Auge und hatte dann innerhalb kurzer Zeit die Angst entwickelt, ich könnte jetzt womöglich eine Netzhautablösung haben. Vorher hatte ich so etwas noch nie bemerkt, und es schien keine Sehstörung zu sein, wie ich sie kannte, denn sie ging in den nächsten Stunden nicht weg, so dass ich in meiner Panik gleich am Nachmittag zum Augenarzt ging.
Der Arzt diagnostizierte eine harmlose Glaskörpertrübung (Mouche Volante), also nicht so etwas, wie ich es befürchtet hatte, sondern eine harmlose Alterserscheinung. Er sagte mir, dass mir die schwarzen Flecken von nun an erhalten blieben und ich mich daran gewöhnen würde. Ich habe mich über diese Diagnose gefreut, und immer, wenn ich jetzt diese schwarzen Dinger sehe, stören sie mich nicht, weil ich weiß, was es ist.
Ich hätte aber leicht auch anders damit umgehen können. Dem Arzt nicht glauben, zum nächsten und zu noch weiteren gehen und weiter um mein Symptom kreisen. Das Vertrauen verlieren – nicht nur in den Arzt, sondern vor allem in meinen Körper. Und spätestens da hätte ich mir die Frage stellen müssen, ob da nicht vielleicht auch eher meine Angst das eigentliche Problem sein könnte und nicht so sehr die körperliche Symptomatik.
Achtsamkeit gegenüber dem Körper sollte ohne Angst sein, eher ein Lauschen ohne Urteil, eine Beziehung auf Augenhöhe. Kein Kontrollinstrument, sondern ein Dialog. Wahrzunehmen, was ist, ohne es sofort zu bewerten. Anzuerkennen, dass manche Beschwerden bleiben, manche gehen und manche nicht gleich zu verstehen sind.
Ein achtsamer Umgang mit dem Körper erfordert auch ein gesundes Vertrauen in dessen Fähigkeit zur Selbstregulation. Heilung geschieht nicht nur durch Therapie oder Medikamente, sondern zuweilen auch durch die Erlaubnis, nicht sofort einzugreifen.
Das macht schon deswegen Sinn, weil unser Körper nicht in einem stabilen Zustand ist. Wir behandeln ihn zwar oft so, als könnten wir ihn auf ein bestimmtes Level bringen und dann einfrieren. Doch das ist eine Illusion, unser Körper ist in ständiger Veränderung.
Nicht nur im Großen (Altern, Krankheiten, hormonelle Umstellungen), sondern auch im Kleinen: Die Verdauung, die Atmung, die Muskelspannung, die hormonelle Balance, die Zellregeneration – alles bewegt sich dauernd. Und der Wandel betrifft nicht nur die Physiologie, sondern auch die Wahrnehmung. Ein Schmerz, der heute da ist, kann morgen gehen.
Diesen Wandel zu ignorieren, führt zu einer Entfremdung von unserem Körper. Ihn anzunehmen bedeutet, ihn als lebendiges, sich veränderndes System zu begreifen. Nicht als etwas, das irgendwann "fertig" ist.
Wenn wir uns diesem Wandel zuwenden, können wir auch die Chance darin erkennen: Wir können ein Leben lang lernen, uns besser mit unserem Körper zu verbinden. Und eben nicht als Optimierung, sondern als Form der Zuwendung.
Freundschaft mit dem Körper
Wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie wir wollen, entsteht oft hilflose Wut. Oder ein Schuldgefühl: „Was habe ich falsch gemacht?“ Oder: „Warum passiert mir das?“ In unserer Kultur ist beides tief verankert. Wir neigen dazu, entweder uns selbst oder anderen die Schuld zu geben: den Genen, dem Chef, der Kindheit, dem Umfeld.
Dabei ist Krankheit ganz und gar nicht nicht immer eine Folge falschen Verhaltens. Und Gesundheit nicht immer ein Verdienst. Der Wunsch nach Kontrolle erzeugt den Wunsch nach Erklärbarkeit. Aber der Körper ist kein linear-kausales System und das Schuldkonzept ist ungeeignet für die Beschäftigung mit dem Körper.
Statt eines Schuldgefühls sollten wir eine wohlwollende Beziehung zum Körper aufbauen, an die Stelle von Urteilen sollten wir freundliche Aufmerksamkeit setzen, an die Stelle von Kontrolle Vertrauen. Dieses Vertrauen lässt sich nicht erzwingen. Doch es kann wachsen, indem wir uns selbst anders begegnen. Die Frage ist dann: Was braucht unser Körper und was brauchen wir jetzt?
Vertrauen in den Körper bedeutet aber nicht, dass immer alles gut ist oder wird. Es bedeutet, sich nicht bei jedem Schmerz, jedem Ziehen, jedem Unwohlsein sofort in Panik oder Erklärungen zu flüchten. Es bedeutet, dem Körper seine Rhythmen und Zeit zu lassen. Ihm Zuwendung zu geben, ohne ihn zu überfordern.
Derart mit dem eigenen Körper in Beziehung zu treten, bedeutet: Freundschaft mit sich selbst als leibliches Wesen mit Bedürfnissen zu schließen. Diese Art von Freundschaft ist keine Vereinnahmung. Keine Verehrung. Keine Funktionserwartung. Freundschaft heißt: Ich nehme dich ernst. Ich höre dir zu. Ich lerne, was du brauchst. Und ich verstehe, dass du anders bist, als ich es manchmal gern hätte. Manchmal verlange ich auch etwas von dir und mute dir etwas zu. Und ich freue mich an dir, genieße dich. Genieße, was du mir ermöglichst und schenkst.
Und es bedeutet auch, gute Gewohnheiten für wohltuende Rituale zu schaffen: Bewegung, Atmung, Schlaf, Nahrung, Berührung. Und es heißt, zu akzeptieren, dass dieser Körper sich verändert. Wer sich auf diese Freundschaft einlässt, wird vielleicht nicht automatisch gesünder. Aber ganz sicher wird das Leben ganzheitlicher, voller, und oft auch: einfacher.
Der Körper ist nicht das Problem
Das möchte ich Ihnen für Ihr Verhältnis zum Körper heute mitgeben: Körper, Geist und Seele bilden ein System. Aber dieses System lebt nicht im luftleeren Raum. Es ist eingebettet in ein soziales, emotionales und auch spirituelles Feld. Unser Körper reagiert nicht nur auf Gedanken und Gefühle, sondern auch auf Beziehungen, Erwartungen, kulturelle Muster.
Und für Ihren Körper lege ich Ihnen diesen entscheidenden Perspektivwechsel ans Herz: Der Körper ist nicht mein Körper. Er ist der Körper, mit dem ich durchs Leben gehe. Er ist nicht mein Besitz. Er ist nicht Objekt, sondern Subjekt, ist mein Gegenüber. Ein lebendiges System mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, das in ständigem Austausch mit mir und meinem Umfeld steht.
Ich finde es eine schöne Sichtweise, den Körper metaphorisch wie ein Musikinstrument zu verstehen. Ich kann darauf spielen, aber wie die Musik, die ich spiele, klingt, dass hängt stark vom Instrument und seinem Zustand ab. Ich kenne mein Instrument in seinen Eigenheiten und weiß um seine Möglichkeiten. Ich muss es stimmen, pflegen, immer wieder genau hinhören. Das Instrument hat eine eigene Resonanz. Und nur wenn ich die beachte, entsteht Musik. Wenn nicht, entsteht Reibung, Dissonanz oder Verstimmung.
Unser Körper ist ein empfindliches Insrument. Es reagiert auf unsere Lebensumstände, auf unseren inneren Zustand, auf unsere sozialen Beziehungen. Es nimmt auf, was wir denken und fühlen, und es gibt Rückmeldung. Wer lernt, diese Rückmeldung zu verstehen, und mit seinem Körper pfleglich umgeht, entwickelt ein anderes Verhältnis zu ihm und wird länger und mehr Freude an ihm haben.
Wer aufhört, seinen Körper besitzen zu wollen, kann beginnen, ihn wieder zu hören. Wer seinen Körper nicht länger optimieren will, kann beginnen, ihn zu verstehen. Wer Freundschaft mit ihm schließt, wird keine Angst mehr haben vor dem, was sich verändert.
Ihr Körper ist nicht das Problem. Er kann Ihr Freund sein. Ob er das wird, hängt davon ab, wie Sie mit sich selbst umgehen. Wie Sie mit Ihrem Körper sprechen. Und ob Sie bereit sind, ihm zuzuhören.