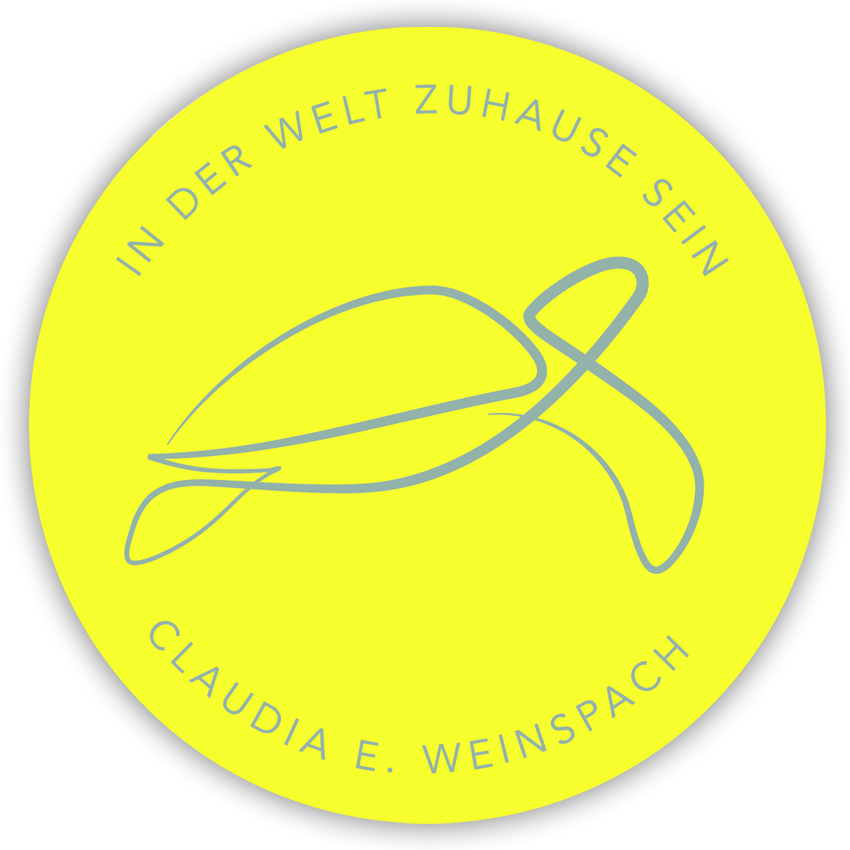September 2025

Welche Beziehung haben Sie zu sich selbst?
Im vergangenen Monat habe ich hier für Sie über die Frage, in welcher Beziehung wir Menschen zu anderen stehen, geschrieben. Darüber, dass wir alle ein Umfeld brauchen, das uns bestärkt, und Beziehungen, in denen wir und das, was wir tun, nicht bewertet, sondern begleitet werden.
Über eine andere Beziehung, die für uns alle sehr wichtig ist, haben wir aber noch nicht gesprochen: unsere Beziehung zu uns selbst. Manch einer von Ihnen wird bei diesem Begriff vielleicht zusammenzucken und denken: Beziehung zu mir selbst – was ist denn das schon wieder für eine Psychologen-Idee? Ich bin doch ich – und fertig. Und andere fragen sich vielleicht: Wozu soll es überhaupt notwendig sein, dass ich nun auch noch eine Beziehung zu mir selbst habe?
Tatsächlich könnte man ja einwenden, dass zu Beziehungen doch immer so etwas wie ein Subjekt und ein Objekt gehört – und wie soll ich gleichzeitig beides sein können? Andererseits ist den meisten von uns die durch die Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl geprägte populäre Vorstellung von dem „Kind in mir” geläufig. Und auch der zum geflügelten Wort gewordene Buchtitel des Philosophen Richard David Precht „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?” hat viele Menschen mit der Idee konfrontiert, dass es ins uns schon etwas komplexer aussehen mag, als es uns normalerweise bewusst ist.
Auch in diesem Blog haben wir uns in diesem Jahr unter der Fragestellung „Was bedeutet es, Mensch zu sein?” schon mit den verschiedenen Facetten beschäftigt, die uns ausmachen: mit unserem Geist, unseren Gefühlen, unserem Körper und schließlich unseren Beziehungen zu anderen. Alle diese Aspekte sind Teile von uns, zu denen wir in Beziehung treten, ob wir es nun wollen oder nicht. Schauen wir also heute mal gemeinsam auf diese ganz besondere Beziehung – zu uns selbst.
Teile der Wahrheit über uns
Einer meiner Klienten zeichnet sich dadurch aus, dass er beruflich viel Verantwortung übernimmt. Er arbeitet als Führungskraft erfolgreich, hat das Vertrauen seiner Vorgesetzten und somit viel freie Hand für all das, was er angeht.
Wenn er in einer guten Phase ist und sich kraftvoll fühlt, dann ist er von sich selbst überzeugt, dass er alles hinbekommt. Obwohl er auch Risiken eingeht – kalkulierbare zwar, aber er sichert sich nicht immer dabei ab, sondern sagt: „Manchmal muss man etwas wagen und einfach ausprobieren, damit es weitergeht – auch wenn es Regeln gibt, die das nicht gestatten.” In diesem Teil seiner selbst fühlt er sich fast unverletzlich, unangreifbar, willensstark – einfach mit beiden Beinen im Leben.
Es gibt aber auf der anderen Seite auch Phasen, wo das ganz anders ist, wo er das Gefühl hat, dass er zum Beispiel kleinste Entscheidungen wie die Frage, wie er seine Waschmaschine repariert bekommt, nicht treffen kann – und sich selbst dafür Vorwürfe macht. Dann hat er Angst, fühlt sich depressiv und greift manchmal auch zur Eigenmedikation in Form von Alkohol. In solchen Phasen ist bei ihm kein Selbstgefühl oder Selbstwertgefühl vorhanden. Dann sieht er sich komplett als Versager, und er hat keinen Zugang zu dem anderen Teil von ihm, von dem ich zuerst erzählt habe.
Diese Ambivalenz in seinem Blick auf sich selbst – einerseits der erfolgreiche, wagemutige, anpackende, von sich selbst überzeugte Mensch, andererseits der ängstliche, schwache Typ, der überhaupt nichts gebacken bekommt und dann Depressionen hat – ich vermute, dass Sie Ähnliches von sich selbst kennen, viele von uns haben solche Ambivalenzen in der Beziehung zu sich selbst.
Beide Seiten dieser Ambivalenz bei meinem Klienten sind real, beide machen ihn aus, und doch sind sie höchst unterschiedlich. Wir Psychologen reden in diesem Zusammenhang über „Teile“ – und in diesem Sinne sind auch die erwähnten menschlichen Facetten wie Geist, Gefühle, Körper und Beziehungen Teile von uns. Ich gebe zu, das klingt im ersten Moment etwas skurril, und natürlich dürfen wir uns das nicht so vorstellen, als bestünden wir aus unabhängig voneinander existierenden Einzelteilen: Wir sind eben nicht nur stark oder nur schwach, sind nicht nur kindlich oder nur erwachsen, nicht nur unser Gefühl oder nur unsere Gedanken.
Dennoch ist es aber so – und deswegen haben wir uns ja in diesem Blog auch schon mit unseren verschiedenen Facetten beschäftigt –, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf uns schauen können und dadurch ganz unterschiedliche Teil-Bilder von uns wahrnehmen.
Zu diesen Teil-Bildern stehen wir, da sie so unterschiedlich sind, auch in ganz unterschiedlicher Beziehung. Manche mögen wir, manche mögen wir nicht, einige vernachlässigen wir oder bewerten sie über, weil wir nur sie sehen, einige sind uns gar nicht bewusst. Aber wir bestehen immer aus der Summe dieser Teile, und eine vollständige Beziehung zu uns selbst entwickeln wir nur, wenn wir uns in der Fülle der Teile wahrnehmen und akzeptieren können.
Die Begriffe Selbstvertrauen oder auch Selbstbewusstsein spiegeln wider, worum es da gehen kann: sich selbst zu vertrauen ist eine gute Idee, um Selbstbewusstsein zu erlangen. Dann fühlen wir uns wohl in unserer Haut, fühlen uns in der Regel kompetent, stark und selbstwirksam genug, um unser Leben zu meistern.
Selbstbewusstsein können wir aber keinesfalls nur durch gedankliche Reflexion erreichen. Sie ist zwar hierfür auf jeden Fall ein nützlicher Weg, aber wir können es vor allem auch durch Vertrauen in die eigene Intuition finden: wenn wir zum Beispiel eine starke Empfindung haben, dass es so, wie es gerade ist, für uns richtig ist. Dann ist das auch eine Form von Bewusstsein, die wir eher über die Welt des Erlebens, über die Welt der Sinne erlangen.
Bewusstsein hat hier eher eine wahrnehmende Qualität, indem ich zum Beispiel wahrnehme, was ich sehe, oder wenn ich etwas rieche, fühle, höre etc. Innere Bilder und Erinnerungen gehören ebenso dazu wie unsere antizipierten Vorstellungen von der Zukunft. Das alles sind Bewusstseinsformen, und die Art, wie sie miteinander zusammenhängen, ist uns in der Regel unbewusst, aber das Zusammenspiel macht unsere Selbstbeziehung aus.
Gerade in herausfordernden Situationen und Lebensphasen; wenn es um Entscheidungen geht, wenn man in eine ungewisse Zukunft schaut oder in der Gegenwart mit schwierigen Lebensumständen konfrontiert ist, ist es wichtig, dass wir neben den guten Beziehungen, über die wir im letzten Blogtext gesprochen haben, auch eine Form des Bewusstseins von uns selbst in unseren unterschiedlichen Teilen finden, dass wir also auf tieferen Ebenen genauer hinschauen, mit uns selbst ins Reine kommen und eine gute Beziehung zu uns selbst entwickeln.
Unterschiedliche Modelle
Zu diesen Teilen, die uns ausmachen, gibt es unterschiedliche psychologische Entwicklungsmodelle, zum Beispiel das Strukturmodell der Transaktionsanalyse von Eric Berne. Ich finde sein Modell in diesem Kontext zur Erläuterung geeignet und griffig, weil es unterschiedliche Teile abbildet: Da gibt es ein „Kind-Ich“, ein „Erwachsenen-Ich“ und ein „Eltern-Ich“.
Diese Ichs sind dann noch mal aufgeteilt. Im „Kind-Ich“ gibt es ein „Freies Kind”. Das „Freie Kind“ enthält unsere selbstimmanente Natur, so wie wir auf die Welt kommen. Die Grundhaltung des freien Kindes ist: „Ich bin da, ich bin das Zentrum der Welt, ich bin geliebt“ und „ich bin ich“. Berne beschreibt in seinem Modell außerdem das „Angepasste Kind“, das den Regeln seiner Umgebung immer folgt, das brav ist, das vor allem die Erwartungen der Eltern erfüllt. Und es gibt das „Rebellische Kind“, das sich im Gegensatz zum braven Kind dagegen stellt und wehrt und bestimmte Dinge einfach nicht will.
In der weiteren Entwicklung des Kindes entsteht mit der Zeit das „Erwachsenen-Ich.“ Im „Erwachsenen-Ich“ sitzt der rationale Verstand mit der Fähigkeit, Realitäten in der Welt wahrzunehmen, zusammenzufügen und weiter zu entwickeln. Alle logischen Zusammenhänge. aber auch das Wissen von Fakten über die Welt sind hier beheimatet.
Das „Eltern-Ich“, der dritter Teil im Strukturmodell der Transaktionsanalyse, entsteht aus einer Art partieller Verinnerlichung unserer Eltern oder anderer Bezugspersonen, die uns in unserer Entwicklung begleiten. Auch hier gibt es eine weitere Unterteilung: Einerseits ist da das „Nährende Eltern-Ich“, welches uns fördert, für uns sorgt, uns schützt. Wie früher die Eltern, die sich um uns kümmern und uns liebevolle Geborgenheit schenken, ist es liebevoll zugewandt.
Zugleich gibt es aber auch das „beobachtende oder kritische Eltern-Ich“, das mit dem Status Quo nicht zufrieden ist und Botschaften gibt wie: „Das musst du besser bzw. schneller machen, das ist nicht gut genug, sei anders“. Letzteres ist dann das, was im „Kind-Ich“ einerseits ängstliche Anpassung und andererseits wütende Rebellion hervorruft.
Es gibt auch andere Modelle, etwa das "Innere Team" des Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun, das verschiedene Persönlichkeitsanteile oder innere Stimmen (z. B. den „inneren Antreiber“, den „Zweifler“, den „Mutmacher“ oder den „inneren Kritiker“) als Mitglieder eines Teams beschreibt, welche unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen. Das Ziel dieses Modells ist es, durch eine systemische Betrachtung der inneren Pluralität zur Selbstklärung, Entscheidungsfindung und besseren Selbstführung zu gelangen, indem man die verschiedenen Anteile hört, wertschätzt und in einen konstruktiven Dialog bringt.
Im Grunde spielt es keine so große Rolle, wie man die Pluralität in sich selbst bezeichnet, solange man sie als solche erkennt. Ich selbst verwende häufig den Begriff „Teilearbeit“ aus der Hypnose und erfrage die Vorstellungen meiner Klienten. Fast immer gibt es innere Bilder, die ich dann gern für die gemeinsame Arbeit übernehme. Es geht mir hierbei auch nicht unbedingt um eine vollständige Abbildung der Gesamtpersönlichkeit wie in den Modellen, sondern vor allem erst einmal darum, bestimmte Teile, die sich schwierig anfühlen – in der Regel die Teile, die wir in uns ablehnen –, zur Sprache zu bringen.
Welches Modell auch immer man selbst favorisiert: Eine gute Selbstbeziehung zeichnet aus, dass unsere verschiedenen Ichs, Teammitglieder oder einfach Teile in einer Art dynamischer Balance oder Harmonie miteinander sind, dass es nicht zu viel Spannung oder andauernde erosive Reibung zwischen ihnen gibt. Im Ergebnis hieße das, dass wir im Großen und Ganzen über uns selbst sagen können: „So, wie ich bin, bin ich richtig. Ja, ich habe meine Stärken und eben auch so meine Schwächen, ich mache manchmal Fehler, habe auch meine Momente, in denen ich ein bisschen größenwahnsinnig werde oder vielleicht irgendetwas Verrücktes mache – aber unterm Strich bin ich zufrieden mit mir, wie ich bin in der Welt, in der ich lebe.“
Vollständiger werden
Bei der Frage, welche Beziehung wir zu uns selbst haben, geht es letztlich darum, dass wir mehr Verbindung zu unseren verschiedenen Teilen herstellen, die natürlich keiner von uns in der Gesamtheit immer im Blick hat. Es geht auch, wie gesagt, nicht unbedingt um Vollständigkeit, sondern eher darum, dass wir uns überhaupt selbst besser kennenlernen und uns dann mehr in dem vertrauen, was wir von uns kennen.
Viele Menschen haben zunächst Angst davor. „Vielleicht wird es dann noch schlimmer?“, ist eine der Fragen, mit denen ich oft konfrontiert bin. Ich erlebe das zum Beispiel in meiner Hypnosearbeit. Da gibt es die Sorge: Was finde ich in mir vor, was ist da in meinem Unbewussten, was taucht da auf einmal auf in mir, was ich nicht kenne? Welche Leiche gibt es in meinem Keller?
Darauf kann ich immer nur sagen, dass es in der Regel zwar die eine oder andere „Leiche“, aber auch viel Schönheit zu entdecken gibt. Manchmal gibt es Vergessenes, manchmal gibt es auch Verletztes, aber insgesamt muss das keiner fürchten, sondern kann sich auch darauf freuen – weil es für uns alle bedeutet, vollständiger im eigenen Leben anwesend zu sein.
Je mehr wir unsere innere Fülle nicht nur reflektieren und bewerten, sondern sie auch erleben können, desto lebendiger fühlen wir uns. Die gute Beziehung zu uns selbst führt idealerweise dahin, dass wir noch viel mehr Gelassenheit im Hier und Jetzt erlangen und dadurch klarer spüren, was wir wirklich wollen und brauchen.
Wenn wir mehr Bewusstsein für uns selbst haben, müssen wir auch nicht immer auf alle Reize sofort reagieren, auf alles, was da von außen auf uns einprasselt oder was uns innerlich lockt. Wenn wir in uns selbst eine gewisse Ruhe oder Stabilität erleben, können wir spontan viel besser entscheiden, was in dem Moment gut für uns ist.
Eine gute Beziehung zu uns selbst zu haben, bedeutet aber natürlich nicht, dass wir uns immer nur attraktiv, schlau und insgesamt einfach toll finden müssen. Sondern es heißt, dass wir uns gut kennen und uns wohlwollend betrachten als die, die wir sind und werden können.
Es bedeutet auch nicht unbedingt, dass wir uns selbst in allen Aspekten innig lieben müssen. Es reicht zunächst schon eine gewisse Freundlichkeit und Unvoreingenommenheit allem gegenüber, was uns innerlich ausmacht, damit wir nicht Teile von uns bekämpfen. Es reicht vollkommen, wenn wir es schaffen, uns anzunehmen, zu akzeptieren, wie wir sind. Ein persönliches Mantra könnte zum Beispiel sein: „Auch wenn ich manchmal zu viel esse, Alkohol trinke etc., mag ich mich so, wie ich bin.“ Oder: „Auch wenn ich mich manchmal nicht leiden kann, akzeptiere ich mich insgesamt so, wie ich bin.“
Die Welt ist dynamisch, und wir sind voller Dynamik, wir verändern uns immer weiter. Wir bleiben nicht so, wie wir sind, indem wir mit der Welt, in der wir sind, interagieren und das, was wir da vorfinden, in uns selbst wieder bearbeiten: Teile davon integrieren, Teile wieder rausschmeißen.
Und es geht auch nicht darum, dass wir uns, wie es heute weit verbreitet ist, in irgendein Ideal hinein optimieren und meinen, nur wenn wir jetzt so und so sind – körperlich, aber auch mental – , dann wären wir gute Menschen. Sondern es geht eher darum, mit dem, was wir in uns vorfinden, für uns selbst eine gute Geschichte zu kreieren, die uns mit persönlichem Sinn erfüllt und bei der wir das Gefühl haben, dass sie uns entspricht und auch in den Bezügen, in denen wir sind, Sinn macht.
Mein Mentor Carl Hammerschlag hat in diesem Sinne immer gesagt, Heilungsarbeit bestehe darin, „to create new endings to old stories“. Denn es gibt immer irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit, die mit Verletzungen verknüpft sind, wie bei meinem Klienten, der in der Schule erlebt hat, ausgegrenzt zu werden und viel Angst zu haben. Der es jetzt aber heute geschafft hat, seinen Kollegen zu sagen, wenn es ihm nicht gut geht, und der dadurch nun das Gegenteil erfährt und nicht mehr ausgegrenzt wird, sondern viel Zuspruch bekommt. Mit der Zeit kann er so lernen, auch diesen ängstlichen Teil von sich selbst anzunehmen und sich nicht mehr die ganze Zeit selbst zu bekämpfen.
Schließlich möchte ich Sie auch noch davor bewahren, es mit der Selbstbeziehung zu übertreiben. Indem Sie sich etwa ständig vor jedem Schritt, den Sie gehen wollen, selbst fragen: Will ich das wirklich, wie stehe ich dazu, habe ich jetzt wirklich auch alles bedacht? Nein, das ist damit überhaupt nicht gemeint.
Wenn wir hier einmal das Bild vom „Inneren Team” verwenden: Sie müssen nicht für jede Entscheidung gleich eine Konferenz einberufen, in der das gesamte „Innere Team” zusammensitzt. Das ist dann wie in Unternehmen, wo ständig Meetings stattfinden, die mehr blockieren als Dinge nach vorne bringen. Da entsteht zu viel Verwaltung, zu viel Bürokratie. Der Reichtum Ihrer inneren Welt ist da. Den zu kennen und sich damit zu beschäftigen ist gut – aber die Beschäftigung soll sie beleben und nicht lähmen.
All das, was Sie erleben, was Sie tun, wie Sie in Beziehung treten nach außen und nach innen, wirkt aufeinander ein und bringt Sie, wenn Sie eine vertrauensvollere, positivere, optimistischere Haltung nach innen haben, dazu, den nächsten Schritt auf eine bestimmte Weise zu tun. Dann fühlen Sie sich allem eher gewachsen, gleichzeitig haben Sie einen anderen, offeneren Blick in die Welt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende und bereichernde Begegnung und Beziehung mit Ihnen selbst – lassen Sie sich auf sich ein, geben Sie sich die Chance auf eine erfüllende Beziehung.